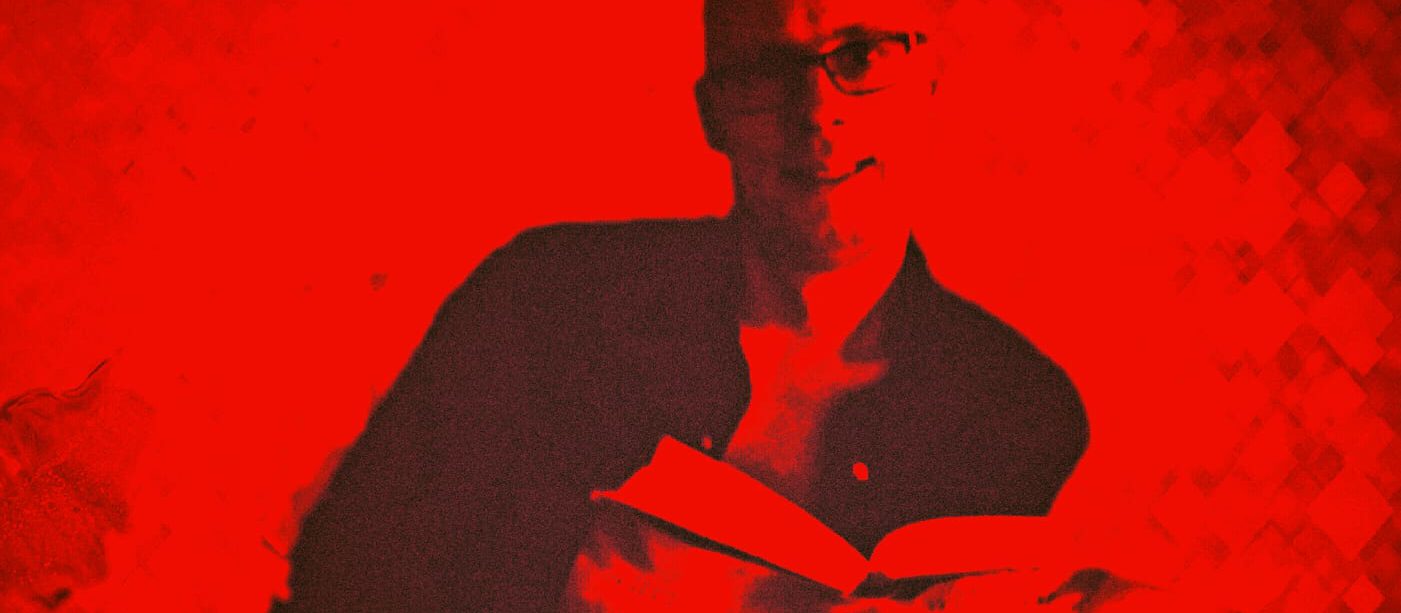Das Geständnis des Läufers, Roman
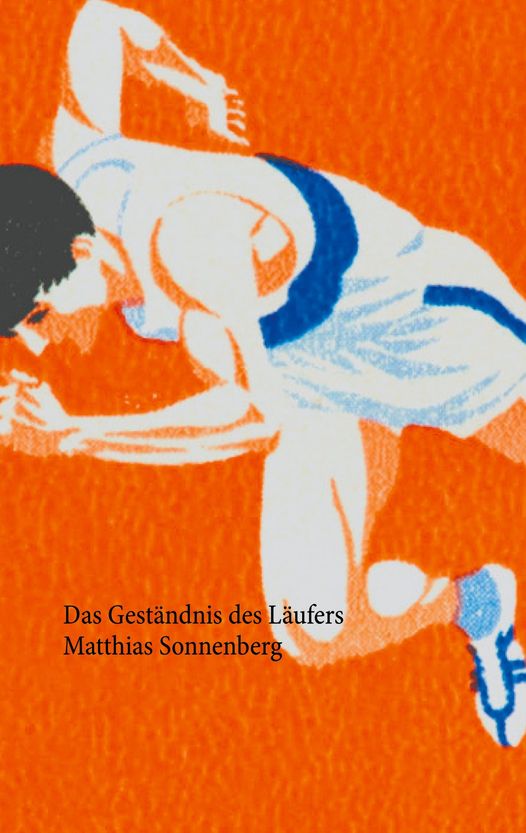
Rezensionen
„Ein ungewöhnlicher Roman, der dank seiner Ansiedlung in der Leistungssportszene dem Leser gleichzeitig ein Stück DDR-Kulturgeschichte vermittelt, was aufgrund der ausgezeichneten Recherche ungemein fesselnd ist. Martins Jugend in der DDR wird einfühlsam und lebensecht gezeichnet. Sein Ehrgeiz und Wille zum Sieg als Mittel zum Zweck, um seine Flucht vorzubereiten, werden emotional großartig aufgebaut und gipfeln schließlich in einem glaubwürdigen Höhepunkt. Auch seine psychische Neurose, die ihn von Zeit zu Zeit plötzlich überfällt und zu einem „bösen“ Menschen macht, lassen diese Figur noch einmal zu einem besonderen Typus werden, der sich quasi über die Massen der Normalos erhebt, wenn auch in diesem Kontext nicht im positiven Sinne. Aber es sind von jeher die außergewöhnlichen Protagonisten, die großen Romanen ihr Leben einhauchen. Und dieser Martin könnte einer von ihnen sein….“
Gaby Hoffman, Autorin
„Sehr spannend zu lesen. Es geht um DDR-Sport, Stasi vor und nach der Wende, Mord, Rache, Flucht. Alt-Nazis in Südamerika. Besonders gut gefallen hat mir, dass im zweiten Teil dem Roman der Blickwinkel eines Stasi-Offiziers hinzugegeben wurde.“
Urs Wegscheider, Lektor
„Was für ’ne fiese Geschichte. Teil 2 ist ein toller Einfall.“
Kirsten Hass, Kulturdezernentin
Leseprobe Das Geständnis des Läufers
1
„Über mir kleben neben verblichenen Wasserflecken zwei erschlagene Mosquitos an der Decke. Seit Stunden beobachte ich sie schon. Mal werden sie kleiner, mal größer, mal verschwimmen sie. Ihr getrocknetes Blut leuchtet noch ganz frisch, wie Erdbeeren. Ja, wie frische Erdbeeren. Mein Bett ist nicht mehr frisch. Es stinkt nach muffiger Strohmatratze und Schweiß. Ich schwitze. Unter meinem Rücken ist alles nass und schmierig. Meine Achseln riechen wie vergorene Ziegenmilch. Eine Sauerei ist das. Und das Atmen fällt mir schwer.
Ich kriege nur im Liegen Luft, mit einem Kissen im Rücken. Diese Schwüle! Aber ich will nicht jammern und über Krankheiten reden oder zermatschte Mosquitos, sondern über etwas, das lange zurückliegt. Seit über zehn Jahren schleppe ich das mit mir herum. Hier in der Pampa, wo es nur Staub, Sonne und blökende Rinder gibt. Es kommt immer wieder hoch. Ich sehe den Glitzerstaub auf ihrer Stirn, ihren starren Blick, ihre erbleichenden Wangen und das letzte Zucken ihrer Unterlippe. Ich sehe sie im Schlaf, beim Treiben der Kühe, am Lagerfeuer und gerade jetzt. Das muss endlich raus! Ich kann nicht länger schweigen.
2
Aber wo beginnen? Vielleicht bei dem Spaziergang an der Mulde. Das war vor zweiundzwanzig Jahren, im Oktober 1969. In der DDR, in Wolkenburg, Bezirk Karl-Marx-Stadt. Ich war elf und hatte Herbstferien. Die Sonne schien mild, die gelb und braun gewordenen Blätter segelten von den Bäumen und Kastanien knallten auf die Straße, rollten umher. Letzte Fliegen kreisten kraftlos durch die Luft. Meine Mutter hatte mich gebeten, mit ihr an den Fluss zu gehen. Gern kam ich dem nach, so konnte ich Kiesel in das trübe, schaumbedeckte Wasser werfen und am Ufer nach Spielzeug, toten Fischen oder Flaschen suchen. Oder nach noch interessanteren Dingen. Einmal fand ich eine Handtasche mit Geld und einen Lederfußball, später ein Kirchenkreuz, ein aufgedunsenes Schwein, eine SED-Fahne mit herausgeschnittenem Emblem, BHs, ein Trabi-Dach, zwei bemalte Klobrillen und sogar, bei Wassertiefstand, ein verrostetes Motorrad und alte Gewehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Absurditäten aller Art. An den Gestank von Schlamm, Weichspüler und Abwasser, der aus dem Fluss stieg, hatte ich mich gewöhnt. Kannte es nicht anders. Der Geruch kam von der Textilfabrik mit den Waschmaschinen, die einige Kilometer flussaufwärts stand, und war mal stärker, mal schwächer. An jenem Oktobertag war er besonders stark. Es schäumte wild. Weiße Blasenhaufen glitten über das Wasser, die der Wind über das Ufer hinaus bis in die Auen verteilte. Sogar in den verkrüppelten Weiden und Holundersträuchern klebte der Schaum. Und alles war umstrahlt vom Sonnenlicht.
„Na geh schon runter!“, rief meine Mutter, als sie bemerkte, dass ich auf die Steine am Fluss schielte. „Aber pass ja auf!“
Das tat ich und sprang vorsichtig von Stein zu Stein. Immer die Zwischenräume der Findlinge absuchend, um keine Rarität zu übersehen. Schon manches Mal hatte ich in die Schule nach Penig das eine oder andere Fundstück für meine Freunde Gunnar und Felix mitgebracht. Ich war bekannt dafür, dass ich Schätze hob. Ich glaube, man beneidete mich sogar deswegen. Wer wohnte schon so nah am Fluss und konnte solch spannende Dinge bergen? Gerade als ich zwischen zwei Findlingen nach einer Flasche greifen wollte, zuckte ich zusammen. Vor mir saß ein Mann. In blauer Schlosserjacke und gelben, dreckverschmierten Gummistiefeln. Den hatte ich noch nie gesehen. Er hockte auf einem dieser Steine und starrte aufs Wasser. Dabei drehte er einen Grashalm zwischen den Fingern. An seiner Hand bröckelte die Kruste einer Schürfwunde.
„Na?“, fragte er mit merkwürdigem Unterton. „Tag!“, gab ich zurück und nickte. Er schaute mich mit dunklen Augen durchdringend an. Ein stechender Blick, hinter dem etwas Unheimliches schwoll. Darüber wucherten buschige, zusammengewachsene Augenbrauen und dichte silbergraue Haare. Ich roch sein süßes, fliederähnliches Rasierwasser und bekam weiche Knie. Mein Atem stockte. Wollte er etwas von mir? Schnell ging ich weiter. Spürte, dass er mir nachsah. Hastig übersprang ich die Steine, bis ich den Mann ein Stück entfernt glaubte. Folgte er mir? Ich stoppte. Drehte mich um. Nein, doch er sah hinter mir her. Aber er war außer Reichweite. Ich atmete durch. Daraufhin bückte ich mich nach einem flachen Stein, um ihn ins Wasser zu schleudern und damit das befremdliche Gefühl loszuwerden. Und den Rasierwassergeruch. Ich wollte den Kiesel so werfen, dass er mehrfach auf dem Wasser aufschlug, ohne unterzutauchen. Ich hatte mir angewöhnt, die Wasserberührungen dabei zu zählen. Neunmal war mein Rekord, aber jetzt gelang es nicht. Der Stein versank sofort. Wasser spritzte auf. „Mist!“
Ich weiß nicht, was in dem Moment mit mir geschah. Es ist schwer zu erklären. Der Mann war weit weg. Aber plötzlich schlug mein Herz schneller. Direkt nach dem Wurf. In meinem Unterleib kribbelte es, als liefen Ameisen darin umher. Mir wurde sonderbar. Ich dachte, ich würde krank werden. So ein Gefühl stieg immer in mir hoch, wenn sich eine Erkältung anbahnte. Alles um mich herum rückte hinter eine Wand. Ich hörte meine Atmung in mir drin, wie mit einem inneren Ohr. Draußen entfernte sich alles. Als ob es in einem Radio plappert und man hört nur die Stimme. Von dem, was gesagt wird, versteht man nix. Nur Blablabla … Gleichzeitig fällt man in einen dumpfen, zeitlosen Zustand, der sogar angenehm ist. Beunruhigendes wird betäubt und verschüttete Erinnerungen erwachen. Der Verstand dämmert. Und man ist, trotz des inneren Nebels, ganz bei sich selbst. Aber mit einer Erkältung hatte das nichts zu tun. Denn mir schoss das Bild des Mannes ins Bewusstsein. Ohne es zu wollen, ohne dass ich das Bild herbeigedacht hätte, wie eine Urlaubserinnerung von der Ostsee. Dort war ich mit den Eltern oft gewesen. In unserem gelb-grünen Zelt hinter den Dünen vom FKK-Strand, im Kiefernwald von Prerow, wo es nach Chlor und Plumpsklo stank. Der Mann erschien nun noch klarer vor meinem inneren Auge. Diese wulstigen, zuckenden Augenbrauen. Und sein Blick, der nicht mehr durchdringend war, sondern unterwürfig. Wie der von einem verängstigten Hund. Ich stellte mir vor, wie ich einen Stein in die Hand nahm und dem Kerl damit auf den Kopf schlug. Mit voller Härte…“